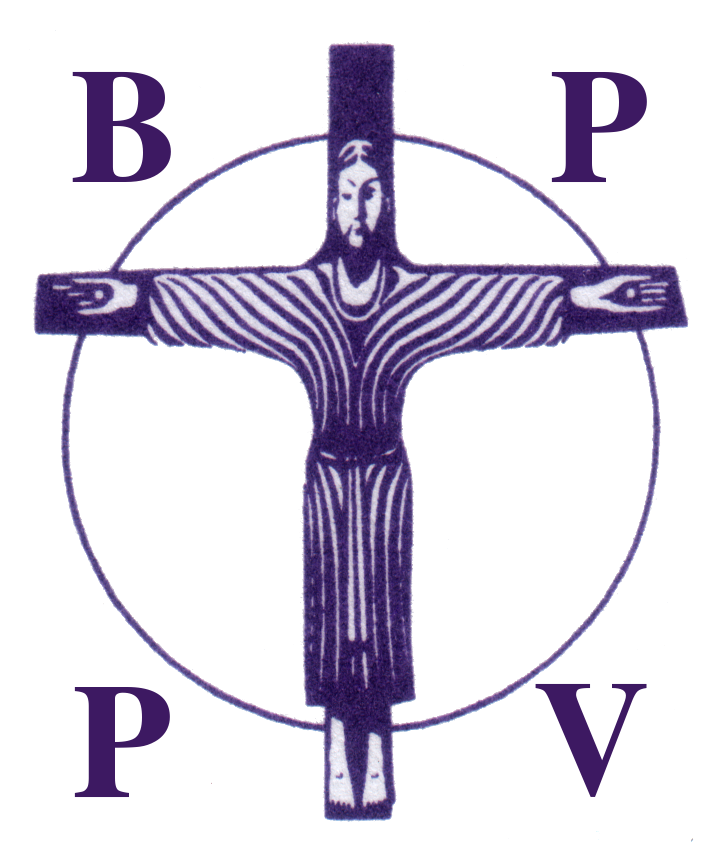Wohl keine Pfarrerin und kein Pfarrer ist Theologe geworden, weil er sich nach Abitur auf dem Arbeitsmarkt umgeschaut hat und dann festgestellt hat, dass das ein interessanter Beruf ist, den es sich zu studieren lohne. Nein, vielmehr werden die meisten eine mehr oder weniger intensive kirchliche Sozialisation genossen haben, etwa in Kinder- und Jugendarbeit, in Chören, bei den Pfadfindern oder in einem anderen Bereich von Kirche. Außerdem dürfte sich mit der Zeit die Wahrnehmung durchgesetzt haben, dass der christliche Glauben an den dreieinigen Gott elementar ist für unser Leben und wir von diesem Glauben weitersagen wollen. Von daher haben die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer ein nicht unerhebliches Sendungsbewusstsein, nämlich von ihrem Glauben und dem, was sie trägt, zu erzählen und das Evangelium in die Welt zu tragen.
All das lässt uns in Blick auf unser Pfarrerin- und Pfarrersein i.d.R. eher von einer „Berufung“ für den Pfarrberuf sprechen, denn von einem Beruf im herkömmlichen Sinne. Einer Berufung, die mindestens ich sogar von Gott persönlich ausgesprochen wahrnehme. Ja, wenn ich auf meinen Werdegang als Pfarrer schaue, würde ich sagen, Gott persönlich hat mich dahin geführt, Pfarrer zu werden. Er hat mich dazu berufen, diesen Berufsweg einzuschlagen.
Das gibt es so in kaum einen anderen Beruf. Am ehesten vielleicht noch bei Politikern, die auch nicht schauen, welche Partei sie mal einstellen würde, sondern aus einer politischen Überzeugung heraus handeln.
Freilich versucht das Theologiestudium, die Themen des Glaubens zu systematisieren und im wissenschaftlichen Sinne eine Lehre vom Glauben zu entwickeln. Aber im Grunde bleibt doch der eigene Glauben und der Berufungsgedanke für den Pfarrberuf konstituierend. Für mich macht all das den Beruf der Pfarrerin bzw. des Pfarrers zu etwas ganz Besonderem, ja, Einzigartigem und zeigt mir, dass der Pfarrberuf mit kaum einem Beruf sonst vergleichbar ist.
Nun unterliegt aber genau dieser Beruf, bzw. das dahinter liegende Berufsbild, zurzeit einem radikalen Wandel (so wird es jedenfalls von vielen empfunden). Zwar hat sich der Pfarrberuf von jeher stetig verändert und stand in der Pflicht, sich an gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen und sich mindestens gedanklich mit dem jeweiligen Zeitgeist auseinanderzusetzen, doch die gegenwärtigen Veränderungen werden von vielen als massiver und radikaler empfunden als in den Jahren zuvor. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen sind das die vielen und rasanten Veränderungen in der Gesellschaft, die ganz allgemein zu einem Bedeutungsverlust von christlichem Glauben und Kirche führen und allein schon deshalb ein Gefühl von Krise aufkommen lassen (was sich natürlich auf unseren Beruf auswirkt). Zum anderen sind das innerkirchliche Veränderungen, die womöglich nicht weniger großen Einfluss auf unser Berufsbild und unseren Berufsalltag haben. Diese innerkirchlichen Veränderungen reagieren auf zwei Grundproblematiken.
1. Die Problematik, dass wir seit den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts ein ökonomisches Problem haben. Wir haben schlicht als Kirche nicht mehr genug Geld, um so weiterzumachen, wie bisher und dieses Problem scheint sich gerade wieder zu verstärken - mindestens aus Kirchenleitender Sicht.
2. Ein personelles Problem. Denn wir haben nicht genug Nachwuchs, um die allgegenwärtige Pensionierungswelle auszugleichen. Auch dafür gibt es viele Gründe und manch einer wird sagen, dass man das doch hätte sehen müssen, wenn man mal in den Kirchenleitungen beizeiten etwas genauer hingeschaut hätte. Das stimmt, führt uns aber letztlich nicht weiter, denn Fakt ist, wir werden immer weniger. Schon jetzt ist das Versorgungsnetz mit Pfarrpersonen an vielen Orten bis zum Zerreißen gespannt. Immer größer sind die zu versorgenden Einheiten geworden und auch die beruflichen Herausforderungen neben unseren Kernkompetenzen sind immer weiter gewachsen. Es ist kein Zufall, dass heute viele gerne von Pfarrerinnen und Pfarrern als „eierlegende Wollmilchsau“ sprechen.
All das beschleunigt den gefühlten und den realen Wandel noch mehr und schreit geradezu nach durchgreifenden Veränderungen. Veränderungen auch und gerade auf struktureller und arbeitsorganisatorischer Ebene. Denn ein „Weiter so“ ist m.E. auch aus unserer Sicht als Pfarrerinnen und Pfarrer nicht möglich. Wir können das Netz nicht einfach immer weiter spannen.
Das nehmen auch Kirchenleitungen wahr und entwickeln aus leitender Sicht Ideen und Konzepte, den bestehenden Herausforderungen zu begegnen. Ich glaube nicht, dass sie das tun, um uns zu ärgern. Diese Ideen und Konzepte treffen uns allerdings trotzdem in unterschiedlicher Weise und Intensität in unserem Berufsalltag und stellen manches, was wir für selbstverständlich halten, in Frage. Da ist das Stichwort der Konzentration wahrscheinlich noch das harmloseste, wonach wir aufgerufen werden, mit unseren Gemeinden vermehrt zu überlegen, welche Aufgaben wir zukünftig noch leisten wollen und können und was wir besser lassen, um so den schwindenden Ressourcen gerecht zu werden.
Vier Themen ergeben sich m.E. zurzeit aus der Problematik.
Erstens die zunehmende Bildung sog. Multiprofessioneller Teams (MPT), die ich insgesamt positiv erlebe. In diesen MPTs arbeiten verschiedene Professionen zusammen und übernehmen gemeinsam Verantwortung für das Leben und die Organisation der Gemeinde. Zwar ist auch die Einführung von MPTs kein Allheilmittel, aber ich glaube und erlebe, dass das tatsächlich eine gute Entwicklung und hilfreiche Maßnahme ist, um der gegenwärtigen Not und Überlastung zu begegnen und zukünftig mit weniger Pfarrpersonen auszukommen. Allerdings führen auch MPTs zu nicht unerheblichen Veränderungen in unserem Berufsalltag, und wir müssen uns als Pfarrerinnen und Pfarrer daran gewöhnen, vermehrt im Team zu arbeiten, nicht alles selbst bestimmen zu können und Verantwortung abzugeben, was nicht jedem leichtfällt.
Vor allem der finanziellen Not scheint mir dagegen ein anderer kirchenleitender Gedanke geschuldet zu sein, den ich nicht so uneingeschränkt positiv sehen kann. Zweitens nämlich die Wandlung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses hin zum privatrechtlichen Angestelltenverhältnis. Hierzu muss man wissen, dass die bayerische Landeskirche schon seit längerem versucht, nach dem Vikariat auf ein Angestelltenverhältnis bei jungen Pfarrerinnen und Pfarrern hinzuwirken, weil das angeblich besser für die junge Pfarrgeneration wäre und ihren Bedürfnissen eher entspräche. Die Ev. Kirche im Rheinland hat jüngst mit überwältigender synodaler Mehrheit einen diesbezüglichen Systemwechsel beschlossen und auch aus Sachsen hört man, dass über eine Umstellung nachgedacht wird. Allerdings scheint das eher ein süddeutsches Thema zu sein, da das im Norden (in der Konförderation, der Nordkirche und der EKO) nach meinem Kenntnisstand bisher kein Thema zu sein scheint.
Argumentiert wird in den entsprechenden Landeskirchen mit erheblichen finanziellen Einsparpotenzialen bei der Pfarrbesoldung. Die Ev. Kirche im Rheinland spricht von einem Sparpotenzial von 1 bis 1,4 Millionen Euro pro Pfarrperson im Laufe der Dienstzeit. Allerdings ist diese Auffassung nicht unumstritten und manch ein Befürworter des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses hält das Sparpotenzial für eine Mogelpackung, in der nicht wirklich alle Kosten berücksichtigt wurden. Hier gilt es noch einmal gut und aufrichtig zu rechnen. Und man hört, dass die Finanzdezernenten der EKD ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben haben, dessen Ergebnisse im Frühherbst vorliegen sollen. Bedacht werden muss auch, dass mit einem solchen Systemwechsel eine enorme Zeit der Umstellung und des Übergangs verbunden wäre. Eine Zeit der Umstellung, in der beide Systeme parallel „gefahren“ werden müssten, was zunächst noch mehr Kosten verursachen würde, und die Frage aufwirft, wie dann das Verhältnis zwischen verbeamteten Pfarrerinnen und Pfarrern einerseits und solchen, die angestellt sind, aussieht. Auch hier gilt es gut zu prüfen, zumal zurzeit keiner wirklich weiß, welche Auswirkungen rechtlich wie inhaltlich dieser Wechsel hin zu Berufsförmigkeit für unseren Beruf konkret hätte. Es ist schlicht gegenwärtig unabsehbar, welch Folgen ein solcher Systemwechsel hätte.
Aber eines sollte klar sein, nur eine Umstellung der Bezahlung, ohne damit verbundene arbeitsrechtliche Veränderungen, kann es aus unserer Sicht nicht geben. Natürlich muss es auch zukünftig die Möglichkeit von Freizeitausgleich für geleistete Überstunden geben. Natürlich braucht es dann eine MAV, die ganz andere Rechte hat als heutige Pfarrvertretungen und natürlich sind Landeskirchen dann anders in der Pflicht, für gute Rahmenbedingungen und wesentlich verbindlichere Dienstbeschreibungen zu sorgen als heute. All das geht, das zeigen uns die meisten Kirchen im europäischen Ausland. Die Frage aber muss lauten, ob man das auch will.
Ein Gutachten, welches der Pfarrerverband vor drei Jahren diesbezüglich in Auftrag gegeben hat, kommt jedenfalls ganz klar zu dem Schluss, dass das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, das für den Pfarrberuf angemessenste ist und den besten Rahmen der notwendigen persönlichen Freiheit im Handeln als Pfarrerin und Pfarrer in Verkündigung, Seelsorge und Unterricht bietet. Von daher sollte man den Beamtenstatus bei Pfarrpersonen nicht zu leichtfertig aufgeben.
Fakt ist, dass dieser Schritt zu einer größeren Berufsförmigkeit des Pfarrberufes führen würde und die bisherige Freiheit und Unabhängigkeit eher einschränkt als fördert. Gleichzeitig kommt allerdings eine solche Berufsförmigkeit gerade jungen Kolleginnen und Kollegen am Anfang ihrer Dienstzeit womöglich eher entgegen. Denn gerade die mit dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis verbundene Freiheit wird nicht selten als überfordernde Entgrenzung wahrgenommen. Immer wieder hört man, dass die jüngere Generation nicht mehr ihr ganzes Leben der Arbeit widmen will und mehr Quality Time beansprucht. Familie wird in anderer Weise als frühere Generationen als gemeinsame Aufgabe mit partnerschaftlicher Aufgabenaufteilung eingefordert und ehrlich gesagt, wer wollte das ernsthaft kritisieren? Abgesehen davon gibt es tatsächlich Dinge, die dem Beamtenrecht entspringen, die heute als wenig zeitgemäß und attraktiv erscheinen. Ich denke etwa an die Residenzpflicht oder die Regelungen zur Erreichbarkeit. Insofern sehnen sich womöglich viele der angehenden und jungen Kolleginnen und Kollegen nach einer Gleichstellung mit anderen Berufen und erhoffen sich davon eine größere Unabhängigkeit in der eigenen Lebensgestaltung.
Dazu passen auch die aktuellen Bestrebungen nach einer verbindlichen Arbeitszeitregelung und ich komme zu drittens: Arbeitszeit.
Tatsächlich ist es vor allem eine Forderung der Pfarrerschaft der letzten 10 Jahre, eine begrenzende und verbindliche Arbeitszeitregelung einzuführen, um andauernden Überforderungstendenzen und regelmäßigen Arbeitswochen von 50 und mehr Stunden vorzubeugen. Ich selbst habe in BS in einer entsprechenden AG mitgearbeitet, und es wurde eine 40 Stundenwoche per Gesetz festgelegt, welche sich über das sog. Terminstundenmodell realisieren lassen soll.
Ich gebe zu, ich war da zunächst skeptisch, denn alles, was man regelt, reglementiert auch. Ich bin froh über die große Freiheit in der zeitlichen Gestaltung meines Berufsalltags und letztlich klagt niemand für mich eine Begrenzung meiner Arbeitszeit ein - ob mit oder ohne Gesetz. Wenn ich mich nicht um meine Arbeitszeit kümmere, tut es keiner. Ich musste aber auch feststellen, dass es durchaus Argumente für eine festgelegte Arbeitszeit gibt.
Einerseits beschreibt sie schlicht den Erwartungshorizont. Es werden zukünftig nicht mehr 50, 56 oder gar 60 Stunden erwartet, sondern 40. Damit lässt sich auch gegenüber Vorgesetzten und Kirchenvorständen, gegenüber Kolleginnen und Kollegen und gegenüber meinen Dienstherren argumentieren. Ich werde zwar trotzdem für mich sorgen müssen, aber mit einer festgelegten Arbeitszeit und dem damit in vielen Kirchen angewandten Terminstundenmodell bekomme ich Argumente an die Hand, mein Aufgabenvolumen sachlich und unabhängig von der Meinung anderer zu beschreiben. Damit kann ich qualifiziert argumentieren, wenn es um die von mir leistbaren Aufgaben geht, was bisher schwieriger war. Tatsächlich halte ich dabei das Terminstundenmodell für ausgesprochen geeignet, die eigene Arbeitszeit zu organisieren. Es fragt nämlich nicht danach, wie viel Zeit ich wirklich für eine bestimmte Aufgabe brauche, sondern bietet einen allgemeingültigen Zeitansatz, der im Mittel für alle Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindedienst gleichermaßen gilt und passt.
Von daher sehe ich die Bestrebungen zur Arbeitszeitregelung inzwischen durchaus positiv.
Wovon ich noch gar nicht gesprochen habe, ist ein weiterer kirchenleitender Gedanke.
Viertens, die Bildung von Großeinheiten bzw. Großgemeinden. Hintergrund ist das Pfotzheimer Modell, wonach die ganze Stadt zu einer Gemeinde fusioniert wurde. In der Pfalz wurde dieses Modell gerade beschlossen und von den bisher 520 Rechtsträgern sollen zukünftig lediglich fünf übrigbleiben. Auch in Braunschweig wird über Gemeinden mit mindestens 40.000 Gemeindeglieder diskutiert, was jedoch gerade in ländlichen Regionen für viel Widerstand sorgt. Klar ist aber, egal wie groß die Einheiten am Ende ausfallen, sie werden größer.
Auch das macht etwas mit den betroffenen Pfarrerinnen und Pfarrern und verändert ihr Berufsbild, ohne dass sich bereits klar abzeichnen würde, was diese Veränderungen konkret bedeuten.
Betrachtet man all diese Veränderungsprozesse, scheint es mir so zu sein, dass Bestrebungen zu mehr Berufsförmigkeit des Pfarrberufes gegenwärtig ausgesprochen aktuell und populär sind, und zwar nicht nur von Kirchenleitender Seite. Was das aber konkret bedeutet, bleibt abzuwarten. Genauso ist zurzeit nicht absehbar, ob mit diesen Veränderungen wirklich ein kritischer Schritt von der Freiheit zur Begrenzung gegangen wird. Wahrscheinlich wird es am Ende sehr darauf ankommen, wie manches konkret umgesetzt und gelebt wird.
Und da können wir alle unseren Beitrag leisten. Die Pfarrvereine und Pfarrvertretungen sollten versuchen, schon früh an den Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Sie sollten nicht per se als Verhinderer, wohl aber als kritische Begleiter und Prüfer auftreten und die Pläne immer wieder mit der Realität abgleichen.
Schließen möchte ich mit einer kleinen Beobachtung der letzten Wochen aus unserer Kirche. Bei unserer innerkirchlichen Diskussion um die bevorstehenden Veränderungsprozesse in Braunschweig, habe ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und es lässt sich ganz klar erkennen, dass ältere Kolleginnen und Kollegen mehr Probleme damit haben, sich auf neues einzulassen als jüngere. Den „Jungen“ macht vieles, was kritisch diskutiert wird, keine Angst. Ganz im Gegenteil, sie sehen sogar für ihre Lebenssituation klare Vorteile und benennen das auch so. Wonach sie sich aber sehnen, ist Klarheit in Blick auf ihre Arbeitssituation und bestmöglichen Schutz vor entgrenzten Erwartungen an ihre Person, die sie nicht erfüllen können.
Vielleicht wäre es von daher an der Zeit, all die anstehenden Themen nicht vor allem mit Pfarrerinnen und Pfarrern zu diskutieren, die kaum noch mehr als 10 Jahre zu arbeiten haben, als vielmehr mit denen, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen und noch mehrere Jahrzehnte im Pfarrberuf vor sich haben.